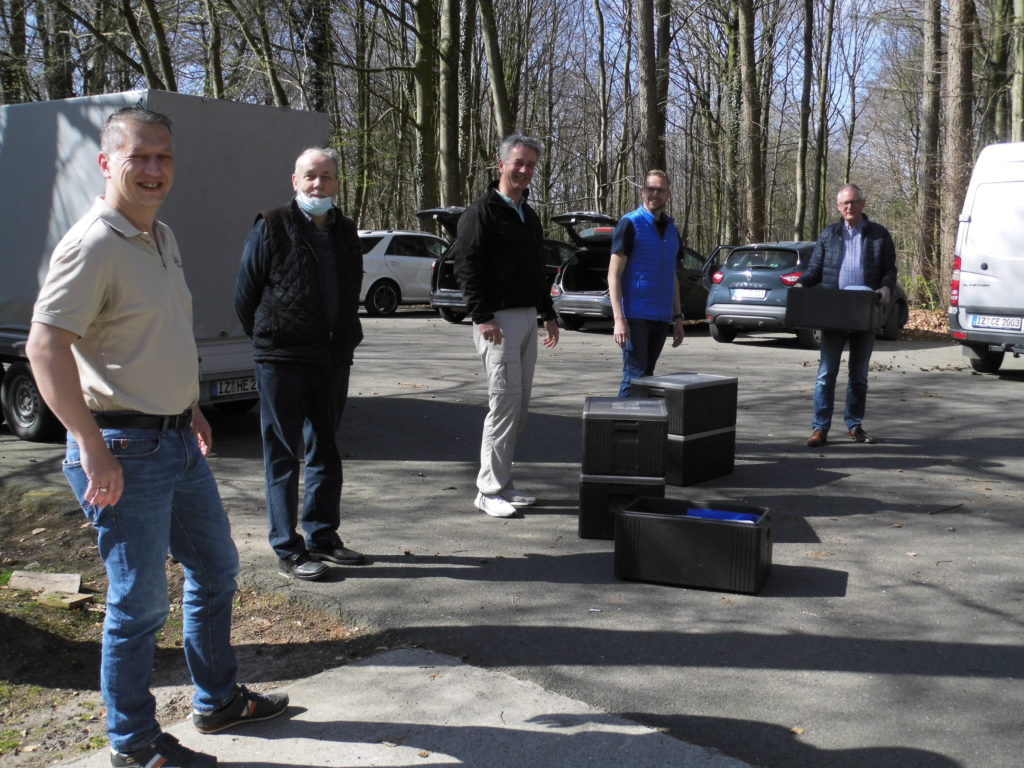Zwei Bilder waren gestern in der „Norddeutschen Rundschau“ abgedruckt, die mich sehr beschäftigt haben. Auf dem einen sind schön bemalte und beklebte Steine zu sehen, die Bewohnerinnen und Bewohner im Klosterforst an einer Straße entlang hingelegt haben. Als Zeichen der Verbundenheit und des Mutmachens und auch, weil es einfach Freude macht, sie zu gestalten. Ich musste an den gern auf Postkarten abgedruckten Ermutigungssprich denken: „Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du Schönes bauen.“ Diese Steine stehen für eine Weise des Umgangs mit der Corona-Pandemie, in der wir versuchen, daraus trotz allem Gutes entstehen zu lassen, „das Beste daraus zu machen“. Bei dem einen oder anderen eventuell auch mit der Zuversicht dahinter, die Dietrich Bonhoeffer so formuliert hat: „Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.“
Das zweite Bild steht unter der Überschrift „Der Enkel am Gartenzaun“: Eine Großmutter sitzt hinter einem hohen Zaun, der Enkel und seine Mutter davor auf einer Decke. Sie lachen sich an, der Enkel streckt die Hände zu seiner Oma aus. Das könnte ein schönes Bild sein, auch unter dem Motto stehen: „Wir machen das Beste draus.“ Aber das Bild trügt. Die Großmutter auf dem Bild ist meine Freundin. Sie lebt in einem Hamburger Seniorenheim, darf seit dem dem 14. März nicht mehr hinaus – und Besuch ist eben nur auf diese eingeschränkte Weise möglich, die der Leiter des Heims immerhin seit einigen Tagen erlaubt. Meine Freundin weint viel, hat Depressionen, mag nicht essen. Nur diese Momente des Besuchs und die Telefonate mit ihren anderen Kindern und mit Freundinnen geben ihr ein wenig Halt. Für viele andere Bewohner von Seniorenheimen ist nicht einmal das möglich.
Die Schutzmaßnahmen sind verständlich. Zu groß ist die Angst der Betreiber von Seniorenheimen, daß Corona sich in ihrem Heim ausbreitet. Mit mehreren Leiterinnen habe ich in den letzten Wochen gesprochen; bei einer Infektion in ihrem Heim gäbe es vermutlich sofort Schuldzuweisungen, erzählen sie, von der eigenen Wahrnehmung, eventuell an irgendeiner Stelle keinen ausreichenden Schutz gewährleistet zu haben, ganz abgesehen. Und doch stellt sich die Frage: Wann ist eine Grenze überschritten? Wann gelingt die Abwägung zwischen notwendigem Schutz vor Corona und mittlerweile erheblicher gesundheitlicher, psychischer und physischer, Beeinträchtigung vieler Menschen durch die Schutzmaßnahmen selbst nicht mehr? Wenn genau die, die besonders geschützt werden sollen, besonders leiden? „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“, heißt es bei Paulus (2. Kor 3,17). Auch die Freiheit, diese Fragen zu stellen.
Pastorin Dr. Wiebke Bähnk